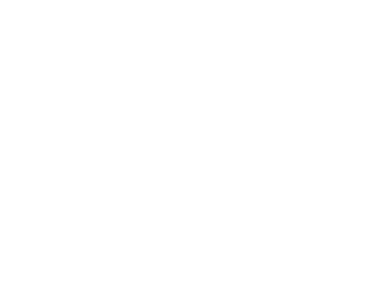Predigt MCC Köln, 16. April 2017
Ines-Paul Baumann
Markus 16,1-8 & Johannes 20,11-18: Osterzeugnisse
Ich kann oft nur schlecht ausblenden, was um mich herum los ist. Ich kann nicht mein Abendessen genießen, während im Fernseher ein Bericht über eine Hungersnot gezeigt wird. Der Fernseher bleibt also solange aus. Ich bezeichne das als meine „Schmalspurfreude“: Manchmal kann ich mich nur dann freuen, wenn ich etwas anderes währenddessen ausblende.
Das geht nicht immer. Ich kann nicht mit Freude ein großes Auto fahren, wenn ich weiß, dass das auf Kosten der Umwelt und meiner Mitmenschen geht. Ich kann mich nicht über Aktien- oder Zinsgewinne freuen, wenn die mit Lebensmittelspekulationen oder Waffengeschäften erworben wurden. Ich mag kein T-Shirt für 5 EUR kaufen (oder ein Smartphone für das 100fache), das unter menschenverachtenden Bedingungen hergestellt wurde. Ich mag von der Krankenkasse keine 30 EUR Jahresbonus erhalten, wenn ich ihr dafür nachweisen soll, was ich alles Tolles für meine Gesundheit getan habe und wie es um meinen BMI steht. Auf solche Dinge verzichte ich also lieber ganz. Als Lebenshaltung finde ich mein Prinzip der Schmalspurfreude fragwürdig und blöd.
Als Jugendlicher fühlte ich mich der Verzweiflung Buddhas sehr nahe, wie er unter dem Feigenbaum sitzt und irgendeine Möglichkeit sucht, mit dem Leid der Welt umgehen zu können. „Alle Erscheinungen sind ohne wahrhafte Existenz“ mag ein philosophisch wertvoller Satz sein und viele humane Ansätze ermöglichen, die Welt zu einer besseren zu machen. Aber für mich schwang darin auch mit, das Leid der Welt für „nicht wirklich“ zu erklären. Ich konnte zwar nachvollziehen, dass das helfen kann, angesichts des Leids überhaupt handlungsfähig zu bleiben (und damit dem Leid und den Leidenden auch begegnen zu können: ein Leid, das „nicht wirklich“ ist, ist vielleicht nicht ganz so überwältigend und lähmend). Aber mich erinnerte es zu sehr an die Schmalspurfreude, die mein Abendessen ohne Fernseher so schön macht. (Das soll keine grundsätzliche Kritik sein an buddhistischen Ansätzen, dem Leid der Welt etwas entgegenzusetzen! Ich erläutere nur, warum der Weg damals FÜR MICH nicht funktioniert hat.)
Ich weiß von einer MCC-Gemeinde in den USA, die sehr viel mit der Technik positiver Gedanken arbeitet und das auch biblisch begründet. Jede Predigt endet mit einer gemeinsamen, positiv formulierten Selbstbestätigung. Meine Skepsis in Sachen Schmalspurfreude wird jedes Mal vor eine große Herausforderung gestellt.
Klar ist es einfach, „Gott zu spüren“ an besonderen Orten, oder inmitten besonderer Menschen, oder inmitten besonderer Zeremonien. Aber ich brauche eine Gott, die auch da ist, wenn ich in meinen Alltag unterwegs bin, wenn ich mit ganz normalen und manchmal nervigen Menschen zusammen bin, und wenn für besondere Zeremonien gerade keine Gelegenheit ist. (Der Jesus, zu dem Gott sich in der Auferstehung bekennen wird, WAR zu meinem großen Glück im Alltag der Menschen unterwegs. ER WAR mit ganz normalen und manchmal nervigen Menschen zusammen – schon seine Jüngerschar zeichnet sich zu einem großen Teil genau dadurch aus. Und in Bezug auf besondere Zeremonien bescheinigten ihm schon seine Gegner, dass er zu viel Zeit mit den Säufern und Fressern verbringe…) Meinen Glauben an die Allgegenwart Gottes möchte ich nicht auf der Basis von Schmalspurfreude praktizieren.
Ich kann auch verstehen, dass es schön ist, im Fußballstadion gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Nur müssen meine Lieder halt auch dann funktionieren, wenn ich sie mit drei Leuten zusammen singe, denen im Leben jegliche Glückseligkeit abhanden gekommen ist. Meine Lieder sollen nicht meiner Schmalspurfreude unterworfen sein.
Natürlich ist es einfach, Gott zu loben, wenn gerade drei Leute Zeugnis abgegeben haben von ihren tollen Erlebnissen mit einem tollen Gott. Nur muss ich meinen Gott auch dann loben können, wenn ich gerade aus einem Seelsorgegespräch komme mit jemanden, der gerade an Gott verzweifelt. Mein Gotteslob soll nicht meiner Schmalspurfreude unterworfen sein.
Und es ist tatsächlich so (sehr zu meinem Leidwesen und dem meiner Familie): Den Ostergottesdienst kann ich immer erst dann vorbereiten, wenn ich durch die Tiefe des Karfreitag hindurchgegangen bin. Sonst wäre ich persönlich auch an Ostern ganz schnell bei einer Schmalspurfreude.
Deswegen bin ich so dankbar für Osterzeugnisse wie diese, die in den Evangelien im biblischen Kanon gelandet sind:
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemand etwas davon; denn sie fürchteten sich.
Markus 16,1-8
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner. Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.
Johannes 20,11-18
Die Auferstehung finde ich genau deswegen so bedeutsam, weil sie nicht am Leiden vorbei geschehen ist, sondern mitten im Leiden und mitten durch das Leiden hindurch. Das gilt zum einen für das Leiden Jesu, und zum anderen für das Leiden der ersten Anhänger_innen Jesu:
An Karfreitag erleben die ersten Anhänger_innen Jesu etwas, was dem Glauben überzeugter Christen sonst eher entgegenzustehen scheint (und was nicht besser wird, nur weil es tatsächlich aus der Bibel statt nur aus dem Munde von Spöttern und Kritikerinnen kommt):
Gott ist tot. Am Ende. Aus der Welt. Nicht nur geschwächt oder missverstanden, sondern zum Schweigen gebracht. Der spielt keine Rolle mehr. Der bringt nichts mehr. Von dem hast du nichts mehr. Da liegt er, der Gott. Kraftlos, getragen nur noch von den Armen einer Frau. Erwärmt nur noch von ihrer Zuwendung. Wenn sie ihn nicht halten würde, würde ihn nichts mehr halten. Er wäre im wahrsten Sinne des Wortes am Boden.
Dieser Gott zählt nicht mehr. Er hat keine Macht, von ihm geht keine Heilung mehr aus und kein Segen und kein Widerspruch. Dieser Gott ist eine Anklage, IST schreiendes Unrecht. Sein Anblick stiftet nicht Freude, sondern zeigt das ganze Elend der Welt.
Der Jesus, dem sich seine Anhänger_innen an Karfreitag gegenübersehen und den sie in aller Unerschrockenheit ansehen, ist tot. Dieser Jesus kann nichts mehr für sie tun. Er kann GAR NICHTS mehr tun. Er kann Gott nicht loben. Er kann keine geistlichen Übungen machen. Er kann nicht beten. Er kann sich nicht in Achtsamkeit üben. Da schlummern keinerlei Potentiale, die entdeckt werden wollen.
Die ersten Reaktionen der Anhänger_innen Jesu damals sprechen Bände. Sie sind entsetzt. Sie sind selber am Ende. Die Botschaft am Grab Jesu, dass Jesu lebendig sein soll, spendet keinen Trost. Im Angesicht dieser Möglichkeit bricht sich ihr Entsetzen erst recht Bahn.
Ich finde diesen Moment wichtig, denn für mich bedeutet das: Hier waren keine Leute mit Schmalspurfreude unterwegs. Sie haben nicht gesagt: „Ach, die Kreuzigung Jesu war eigentlich gar nicht wirklich.“ Oder: „Ach, solange er in unseren Herzen lebendig ist, lebt er doch irgendwie weiter.“ Oder: „Mensch Leute, was ist denn mit eurem Glauben? Jesus war Gottes Sohn, was soll den unterkriegen? Lasst uns einfach weitermachen, jetzt erst recht!“
Schon die ersten Kritiker haben den Anhängern Jesu vorgeworfen, Jesus sei gar nicht wirklich tot gewesen. Wenn wir die Auferstehung wirklich als solche feiern wollen, müssen wir diesen Satz ertragen: Der Gott, der mit Jesus eins ist, war tot. Gott KANN tot sein. (Sonst war und ist Gott nicht eins mit Jesus. Oder Jesus war tatsächlich nicht wirklich tot. Manche Gläubige könnten mit beidem davon leben. Für andere würde es die Basis ihres Glaubens angreifen.)
Nicht umsonst haben sich die Evangelien dagegen gewehrt, dass Jesus nicht wirklich tot gewesen sein soll. Die Auferstehung entfaltet genau dadurch ihre besondere Kraft:
In der Auferstehung bekennt sich Gott zur Schwachheit – auch zu seiner eigenen.
Gott reicht (sich und) dem die Hand, der am Ende ist.
Wo andere hämisch lachen, ist Gott treu zur Seite.
Wo andere verzweifelt den Blick abwenden, schaut Gott hin.
Die Auferstehung versichert mir: Gott bekennt sich zu dem, der von sich aus nichts mehr tun kann.
Jesus wird nicht in dem Moment zum ganz besonderen Gottessohn, wo er voller Macht und Stärke und Charisma allen die Welt erklärt und sich alle vor ihm niederwerfen, die ihn mitbekommen. So hat Jesus nie gelebt. So war er auch nach seiner Auferstehung nicht. Gott bekennt sich in der Auferstehung mit aller Kraft und mit aller Macht zu einem Jesus als Gottessohn, der am Ende ist und der nichts mehr zu tun vermag. Dieses Bekenntnis Gottes gilt seitdem für ALLE Gotteskinder. Wo ich am Ende bin, ist Gott längst nicht am Ende.
(Freilich zeigt Gott ihre Zuwendung NICHT NUR da, wo nichts mehr geht. Gott hat sich AUCH zu Jesus als Gottessohn bekannt, als der Wunder und Zeichen gewirkt hat und im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit stand. Aber auch das eben NICHT NUR.)
Auch als der Auferstandene hat sich Jesus nicht machtvoll in Szene gesetzt und es endlich allen gezeigt. Er war so unscheinbar und alltäglich und normal, dass ihn selbst seine Vertrauten manchmal erst erkannten, als sie durch irgendwas an ihm an das erinnert wurden, was sie früher mit Jesus erlebt hatten: Eine Geste, ein Wort, ein Blick.
Der Auferstandene tritt in den Begegnungen immer wieder anders in Erscheinung. Die Auferstehung führt ihn also weniger zu einem starren, festen Selbst-Ich, das sich nun in aller Unerschütterlichkeit offenbart, à la: „Toll, der ist immer er selbst, egal was um ihn herum gerade los ist.“ Nein, der auferstandene Christus ist immer wieder ein anderer, je nachdem, was um ihn herum gerade los ist.
Weder vor noch nach seiner Kreuzigung zeigt sich in Jesus ein Gott, der überzeugt und überwältigt.
Weder vor noch nach seiner Kreuzigung zeigt sich in Jesus ein Gott, der sich rechtfertigt, erklärt und alles daran setzt, im rechten Licht als das gesehen zu werden, der er ist – und dafür Anerkennung und Verständnis einfordert.
Dieser Gott hält es aus, unerkannt, unbeachtet und missverstanden zu sein.
Dieser Gott hält es aus, nicht von der Überzeugungskraft seiner Erscheinungen und seiner Anhänger_innen abhängig zu sein.
Dieser Gott ist nicht auf einen Schmalspurglauben angewiesen, der nur solange trägt, wie alles Unerfreuliche und Widersprüchliche und Leidvolle ausgeblendet wird.
Auferstehung zeugt von einer Kraft, die nicht dem innewohnt, der sie benötigt. Sie wird mir zuteil.
Auferstehung zeugt von einer Kraft, die nicht erworben, trainiert, entdeckt oder eingeübt wird. Sie wohnt schlichtweg nicht innerhalb meiner Potentiale und Möglichkeiten. Deshalb ist in ihr alles möglich.
Mir tut dieser Auferstandene gut. In ihm zeigt sich ein Gott, der sich zu denen bekennt, die von sich aus zu nichts mehr in der Lage sind. Ich erfahre, dass ich wertvoll bin, auch und gerade da, wo ich mich zu nichts wert fühle und für andere nicht von Wert bin.
Manchmal bin ich unerkannt, unbeachtet und missverstanden. Manchmal macht mir das was aus. Manchmal droht mich das zu lähmen. Aber dann schaue ich auf den Auferstandenen und werde daran erinnert: Darauf kommt es nicht an. Die Quelle meines Daseins liegt woanders. Nicht in mir und meiner Stärke. Nicht in meinem Mitmenschen und der Stärke, die sie mir geben oder nehmen. Gegründet im Auferstandenen ist mein Leben frei von den Bedrohungen und der Enge, die mit menschlicher Stärke verbunden sind. So ruft mich die Auferstehung in ein Leben, in dem ich sein kann – nicht „ich selbst“ in einem unveränderlichen, starrem Sinn. Sondern inmitten aller Umstände eben auch „mal so“ und „mal so“. Manchmal finde ich mich echt stark. Oft bin ich es nicht.
Als Pastor*, als Christin, als Gläubiger, als Mensch: Ich vertrete keinen Gott, der sich immer als stark erweist. Warum sollte ich dann immer einen möglichst starken Glauben haben müssen, in dem sich ein möglichst starker Gott erweist?
Nein, in der Auferstehung bekennt sich Gott dazu, dass mein Glaube und mein Gott nicht davon abhängen, was ich dafür einbringen kann. Es ist nicht mein Glaube, der Gott stark macht. Es ist Gott, die meinen Glauben stark macht.
Und wenn ich manchmal merke, dass ich keinen Mut mehr habe, dass Angst mich erfüllt, dass ich wie wie gelähmt bin und alles Leben weit weg erscheint: Im Auferstandenen reicht Gott mir auch dann ihre Hand und bekennt sich zu mir. Dann bin auch ich wieder in der Lage aufzustehen. Freude und Leid mit anderen zu teilen. Mir und anderen zu begegnen. Nicht nur auf die Starken und Nützlichen zu schauen. Sondern auch da hinzuschauen und da zu sein, wo mir oder anderen die Kraft fehlt. Im Namen dessen, der lebt und dem der Tod nicht mehr die Macht nehmen kann: Im Namen Jesu, dem Auferstandenen!
(Diese Predigt ist kein theologisches Manifest zwingender Logik und beeindruckender Argumentationsketten. Sie zeugt bruchstückhaft von ein paar Aspekten, warum mir persönlich die Auferstehung so wichtig geworden ist. Sie hat mein Leben verändert und verändert es immer noch jeden Tag.)