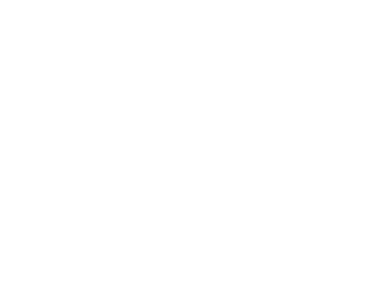Predigt MCC Köln
Ines-Paul Baumann
Lk 10,25-37 „Der barmherzige Samariter“
Ich glaube, uns ist manchmal gar nicht klar, was wir anstellen mit unseren Predigten und Bibelsprüchen. Es ist ja so was von klar, worauf diese Geschichte hinauslaufen soll. Nicht ganz so klar ist meistens, worauf das hinausläuft: Egal, wen aus der Geschichte wir als Modell anbieten, könnten wir Menschen zu Verlierern berufen.
Der Priester und der Levit gehen an dem Notleidenden einfach vorbei: Klar, die beiden haben versagt. Engstirnig und gesetzlich und selbstbezogen sind sie. Ihre Religion ist ihnen wichtiger als ihre Mitmenschen. Auch die heutigen Priester und Kirchenangestellten werden im allgemeinen nicht als die angenehmsten und solidarischsten Zeitgenossen gesehen.
Wenn ich mich mit dem barmherzigen Samariter vergleiche, fühle ich mich aber auch sofort schlecht. Was für Erwartungen! Ich werde ihnen nie genügen können! Die Not in der Welt ist so groß! Selbst wenn ich hier und da helfen kann – alles in allem bin ich auch mal froh, wenn ich nicht jeden Moment mit all dem Leid konfrontiert bin.
Ich kann wahrlich nicht behaupten, dass mich die Not jedes Menschen immer sofort dazu bewegt, alles andere hintenan zu stellen. Was noch viel schlimmer ist, auch wenn es niemand mitbekommt: Nicht nur, dass ich nie genug mache – manchmal fühle ich auch schon gar nichts mehr. Ich bin nicht bei jeder Not so „im Innersten von Mitleid ergriffen, wie das Lukasevangelium es für das Samariter beschreibt. Wenn der Samariter unser Vorbild dafür sein soll, was einen „wahren Christen“ ausmacht, habe ich ganz schlechte Karten.
Bleibt der Wirt, mit dem ich mich identifizieren könnte. Oder auch nicht: der spielt eigentlich nie eine große Rolle, wenn über den barmherzigen Samariter gepredigt wird. Damit gehört er immerhin nicht zu denen, die verurteilt werden – aber zu denen zu gehören, die nie eine Rolle spielen, ist ein hoher Preis dafür.
Also bleibt nur noch der Überfallene. Der macht nix falsch, er wird nicht mit Erwartungen selbstloser Aufopferung überhäuft, und er wird wahrgenommen. Wow, endlich eine angenehme Rolle in dieser Geschichte! Er bekommt die Aufmerksamkeit. Sogar Jesus selbst zieht am Ende seiner Erzählung den Überfallenen heran, um seine Sache auf den Punkt zu bringen. An dem Überfallenen macht sich fest, wer richtig und falsch handelt. Der Überfallene selbst muss sich mit dieser Frage gar nicht auseinandersetzen. So gesehen wäre es am Ende tatsächlich naheliegend, in der Geschichte am liebsten der Überfallene sein zu wollen.
Ist das die Schlussfolgerung, die wir mitnehmen sollen aus Kirchenpredigten? Sollen wir lernen, dass wir als Opfer und als Kranke am besten davon kommen, weil wir dann nicht zu den Schuldigen gehören können und frei sind von Erwartungen?
Wie kommen wir dazu, aus der Erzählung des barmherzigen Samariters eine jahrhundertelange Geschichte unbarmherziger Erwartungen zu machen, die bis heute wirkt?
Im Grunde machen wir genau das, was Jesus mit dieser Erzählung durchbrechen wollte: Wir nehmen unsere Erwartungen als gesicherte Grundlage dafür, wie wir andere und uns sehen wollen.
Bevor Jesus die Geschichte erzählt, stellt er dem Toralehrer eine Frage – genauer gesagt, zwei Fragen: „Was ist in der Tora geschrieben? Wie liest du?“ Und tatsächlich, das sind zwei sehr verschiedene Fragen! Was irgendwo steht, ist das eine. Was wir lesen, ist das andere. Unser Lesen und Verstehen ist immer geprägt von unseren Bildern und Erwartungen.
Wie entscheidend Erwartungen sein können, zeigt dieser Witz:
In einem Dorf befindet sich ein Kloster. Direkt gegenüber ein einschlägiges Etablissement. Eine junge Novizin wird beauftragt, am Fenster (des Klosters!) zu beobachten, wer alles in den Sündenpfuhl hineingeht.
Nach einiger Zeit: „Mutter Oberin! Mutter Oberin! Eben ist der Bürgermeister reingegangen.“ – „Siehst Du, auch die Obrigkeit ist nicht gefeit vor der Sünde.“
Wieder einige Zeit später: „Mutter Oberin! Der evangelische Pfarrer ist gerade reingegangen!“ – „So ergeht es den Irrgläubigen. Auch sie erliegen den Verlockungen des Fleisches.“
Noch einige Zeit später: „Mutter Oberin! Mutter Oberin! Der katholische Pfarrer ist hineingegangen!“ – Die Oberin wird plötzlich kreidebleich und sagt: „Da wird doch wohl keiner gestorben sein?“
In der Erzählung vom barmherzigen Samariter haben wir heute die Erwartung, dass der Priester und der Levit „die Schlechten“ sind und der Samaritaner „der Gute“. Als Jesus die Geschichte damals erzählt hatte, war es genau umgekehrt: Der Priester und der Levit galten als „die Guten“, und der Samaritaner galt als „der Schlechte“ – zumindest in den Augen des Toragelehrten, mit dem Jesus sich hier unterhält. Und damit kehren sich alle Lesarten der Geschichte um. Eine unbarmherzige Geschichte, aus der ich nur als Verlierer hervorgehen kann, wird damit plötzlich zu einer Geschichte, wo mitten in unserer Welt ganz viel Raum ist für Barmherzigkeit.
Der Priester und der Levit gehen vorbei. WIR denken: „Klar, diese Heuchler! Ihre Reinheitsgebote gehen ihnen über alles!“ Der Toragelehrte damals wusste: An den Reinheitsgeboten kann es nicht gelegen haben. Von den Vorschriften her und von ihrer Laufrichtung hätte es keine Einschränkung gegeben (wenn sie denselben Weg genommen hatten wie Jesus für den Überfallenen schildert, gingen sie von ihrem Tempeldienst weg und nicht zu ihm hin). Da der Priester und der Levit bei dem Toragelehrten hohes Ansehen genossen, wird er sie innerlich in Schutz genommen haben für ihr Tun. Vielleicht war es damals eh üblich, so zu handeln, und ihm ist gar nichts Ungewöhnliches dabei aufgefallen. Oder er dachte sich, dass sie schon ihre Gründe gehabt haben werden.
Auch heutzutage gibt es unzählige Sachen, die Menschen durch den Kopf gehen, wenn sie weiterlaufen:
CJ Also, ich habe wirklich keine Zeit!
LS Hilfeleistung kostet Geld. Das brauche ich selbst für mein Alter.
CJ Ich kenne den doch gar nicht.
LS Das viele Blut! Vielleicht hat der AIDS.
CJ Ich kann kein Blut sehen und ekle mich ganz furchtbar.
LS Hier wäre doch der Staat in der Pflicht. Warum zahlen wir denn Steuern?! Der Staat müsste dafür sorgen, dass alle eine ordentliche Krankenversicherung bekommen. Und wenn die Straßen sicherer wären, würde so etwas nicht passieren.
CJ Ich bin allein unterwegs. Das ist vielleicht ein Trick. Der ist gar nicht verletzt und hinter dem nächsten Felsen lauern seine Komplizen
LS Ich fühle mich hilflos
CJ Das nutzt doch gar nichts, wenn ich dem einen helfe, die ganze Welt ist doch unter die Räuber gefallen
Luise Schottroff, Claudia Janssen: Eine Geschichte über die Liebe. Bibelarbeit zu Lk 10, 25-37 (am 12.7.2013 heruntergeladen von www.bibel-in-gerechter-sprache.de/ downloads/ bremen/ Schottroff+Janssen_Bibelarbeit-Lk10.pdf)
Alle, die mit solchen Gedanken weitergelaufen wären, wüssten für sich, warum sie nicht eingegriffen haben. Wenn sie abends ihrer besten Freundin davon erzählen, wird sie nicken und sagen: „Ja, ich kann gut verstehen, warum du weitergegangen bist.“ Wahrscheinlich war der Toragelehrte dem Priester und dem Leviten gegenüber ebenso milde gestimmt.
Ganz anders der Samaritaner. WIR heute denken: „Ah, der Gute betritt die Szene.“ Der Toragelehrte damals wusste: Zwischen Juden und Samaritanern war so gar keine gute Stimmung. Ungefähr so wie heutzutage für viele zwischen Palästina und Israel, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Sowohl die Juden als auch die Samaritaner glaubten an den „einen Gott“; der jeweils andere lag aus ihrer Sicht falsch und lebte falsch. Juden und Samaritaner trauten sich nicht über den Weg. Als Jesus den Samaritaner erwähnte, werden die meisten jüdischen Toragelehrten damals gedacht haben: „Oh nein, ein Samaritaner. Was sollen wir dem schon zutrauen außer Gewalt. Gutes ist von dem sicher nicht zu erwarten!“ Die Erwartungen von Juden an einen Samaritaner damals waren nicht besser als die von manchen ach-so-christlichen Zeitgenossen an Muslime heute: „Was ist von denen schon zu erwarten außer Gewalt?“ (Manche Menschen reagieren genau so auch auf Christen.)
Nach den ersten beiden „Guten“ betritt nun also „so einer“ die Szene. Und „ausgerechnet den“, von dem nix Gutes zu erwarten ist, stellt Jesus nun als das Vorbild dar, an dessen Verhalten sich der Toragelehrte ein Beispiel nehmen soll.
Ähnliches gilt übrigens für den Wirt, wenn auch in milderer Form. Die Herbergen an der Straße von Jerusalem nach Jericho hatten keinen guten Ruf. Ihre Wirte galten als brutal und auf den eigenen ökonomischen Vorteil bedacht. (Es ist sicher kein Zufall, dass ökonomische „Zwänge“ – äh: Sachverhalte – ganz selbstverständlich so viel Anerkennung erfahren.) Aber auch so ein roh gesitteter Wirt ist in der Geschichte Jesu vertrauenswürdig genug, den Überfallenen zur Pflege und eine Menge Geld zu seinem Unterhalt anvertraut zu bekommen.
Fassen wir die damalige Sichtweise auf die Erzählung zusammen: Diejenigen, die hohes Ansehen genießen, handeln nicht gerade vorbildlich, werden aber in den Augen des Zuhörenden eine äußerst milde Beurteilung dafür erfahren. („Sie werden schon ihre Gründe gehabt haben!“) Diejenigen, von denen hingegen nichts Gutes zu erwarten war, sind plötzlich die Gestalten, von denen Gutes ausgeht.
Statt mit „den Guten“ und „den Bösen“ haben wir es nun mit Menschen zu tun. Diejenigen, die im Zentrum der Macht und Anerkennung stehen (der Priester und der Levit), werden „auch nur Menschen“. Und diejenigen, deren Herkunft und Motivation einem Feindbild entsprechen (der Samaritaner und der Wirt), werden Botschafter und Gestalter zwischenmenschlicher Nähe.
Die einen wurden bis hierher zu sehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, die anderen wurden bisher zu sehr an den Rand gedrängt. Beides wird zurechtgerückt.
Die Erwartungen an die einen waren zu hoch, die Erwartungen an die anderen waren zu niedrig. Beide Erwartungen werden korrigiert.
Und auch der Überfallene durchbricht Erwartungen. Im klassischen Computerspiel heutzutage würde am Straßenrand nicht ein überfallener Mann liegen, sondern eine ganz arg hilflose, spindeldürre, knapp bekleidete, langhaarige Blondine. Jesus erzählt hier aber eine Geschichte, in der nur Männer vorkommen. Damit zieht er die Logik seines Themas durch: Die Erwartungen, um die es hier geht, konzentrieren sich in einer Männerwelt. (Die Auseinandersetzung mit den Erwartungen von und an Frauen schildert das Lukas-Evangelium direkt im Anschluss an die Geschichte vom barmherzigen Samariter mit dem Besuch Jesu bei Martha und Maria.)
Mit dem Überfallenen bietet Jesus in diesem Falle Männern eine Rolle an, die sich nicht innerhalb der Klischees bewegt: Auch sie gehören nicht immer zu denen, die das Heft des Handelns in die Hand nehmen müssen. Derjenige, der keine Kraft mehr hat, darf auch mal ganz einfach nichts mehr leisten müssen – weder für sich noch für andere. Er darf schlicht und einfach Empfänger von Nächstenliebe sein. Das ist auch für manche Frauenrolle die viel wichtigere Botschaft als die sonst übliche, immer allen helfen zu sollen. Aber wie die Geschichte deutlich macht, können eben auch Männer mal in so eine Situation geraten, in der sie auf Hilfe von außen angewiesen sind. Jesus unterstützt es, wenn sie diese dann auch annehmen.
Auch der Samaritaner dient nicht als Vorlage für Selbstaufopferung und Pflichtversessenheit. Er folgt gerade nicht irgendeinem Pflichtbewusstsein oder einem schlechten Gewissen. Er folgt allein dem Impuls seines Herzens. Und auch dann opfert er sich nicht auf, sondern verteilt die Pflege auf mehrere Schultern. Damit kümmert er sich gleichzeitig darum, dass er selbst weitergehen kann auf seinem eigenen Weg. Ein Vorbild zu selbstloser Aufopferung sollten wir aus dieser Erzählung nicht stricken!
Genau so wenig können wir aus dem Verhalten des Samaritaners den Schluss ziehen, dass es Jesus hier darum geht, beim Helfen alle Grenzen von Kulturen, Religionen, Wohlstand zu überschreiten. Dann hätte Jesus erwähnen müssen, wie wenig der Überfallene mit dem Samaritaner gemeinsam hat. Vielleicht hat der Samaritaner ja einem anderen Samaritaner geholfen?? Wir wissen es nicht. Jesus lässt es unerwähnt – weil es keine Rolle spielt. In der jüdischen Tradition war klar, dass sich der respektvolle Umgang nicht nur auf den Nachbarn aus der eigenen Ecke beschränkt, sondern auch den Unbekannten, Fremden und Befremdlichen unter den Nachbarn zu gelten hat.
Die Frage „Wer ist mein Nächster“ fasst Jesus nicht so auf : „Wem bin ich nahe genug, damit diese/r meiner Hilfe wert ist?“
Der Weg, den Jesus in seiner Erzählung aufzeigt, ist genau umgekehrt: „Wem lasse ich meine Hilfe zuteil werden und komme ihm/ihr dadurch nahe?“
Trotzdem ist es sicher kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet einen Samaritaner als denjenigen zeigt, der für die Erfahrung von Nächstenliebe zum Botschafter und Gestalter wird. Als Samaritaner hätte er damals sicher nicht davon ausgehen können, dass ihm jemand geholfen hätte, wenn er selber da gelegen hätte. Selber zu denen zu gehören, die nicht immer nur gut angesehen werden, kann in den Subgruppen der Ausgestoßenen zu drei verschiedenen Reaktionen führen (auch in Bezug auf die MCC erlebe ich immer wieder alle drei Aspekte): Erstens kann Ausgrenzung zu Selbstzerfleischung führen (das negative Denken wird übernommen und an sich und seinesgleichen weitergegeben – ihr ahnt gar nicht, wie viel Schwulenhass es unter Schwulen gibt…) Zweitens dazu, sich bei jeder Gelegenheit selber gegen die Ausgegrenzten abzugrenzen und denen anzubiedern, die angeblich zu den Angeseheneren gehören (die Lederschwulen sind die Störenfriede auf dem Weg zur Normalität in der Mitte der Ehe-zentrierten Gesellschaft). Es kann aber drittens auch den Blick schärfen für andere, denen niemand hilft.
Wenn der eigene Blick für diejenigen am Rand erst mal geschärft ist, kann dies eine Motivation zum Handeln werden nicht nur in Hinblick auf aktuelle Not. Es kann auch die Sehnsucht wecken auf eine grundsätzlich anders gebaute Gemeinschaft mit uns selbst, mit einander und im Namen Gottes:
Martin Luther King sagte:
(Zitat Anfang) „Auf der einen Seite sind wir gerufen, der barmherzige Samariter zu sein für alle die, die am Wege liegen geblieben sind. Aber das ist nur ein Anfang. Eines Tages müssen wir begreifen, daß die ganze Straße nach Jericho anders gebaut werden muß, damit nicht fortwährend Männer und Frauen geschlagen und ausgeraubt werden, wenn sie auf der Straße ihres Lebens unterwegs sind. Echtes Mitgefühl besteht in mehr als im Hinwerfen einer Münze in den Hut des Bettlers; es bleibt nicht zufällig und oberflächlich. Es kommt zu der Einsicht, daß ein Haus, das Bettler hervorbringt, umgebaut werden muß.“ (Zitat Ende)
Damit sind wir genau im Zentrum der Geschichte des barmherzigen Samariters: Es ist eine Geschichte von unseren Erwartungen und Vorurteilen – gegenüber denjenigen, die wir für toll und wichtig halten, und gegenüber denjenigen, von denen wir nur Schlechtes erwarten. Es ist nicht nur eine Geschichte von Nächstenliebe im akuten Notfall – diese Geschichte baut die Häuser unserer Erwartungen und Vorurteile um. Vorurteile sind unbarmherzig; sie sind Teil der Überfälle, die Menschen ausrauben und schlagen auf der Straße ihres Lebens. Nächstenliebe, wie sie Jesus lehrt, befreit Menschen aus den Rollenbildern und baut den Raum um, den wir in der Welt gestalten.
Wo wir unsere Rollenbilder ändern (lassen), indem wir uns auf Jesu kompromisslose Liebe einlassen und entsprechend handeln, entsteht aus unbarmherzigen Erwartungen ein barmherziges Miteinander im Umgang mit uns selbst, mit einander und mit Gott.
Wo wir Menschen wahrnehmen statt Erwartungen, genau da „erben“ wir das ewige Leben. Nicht in dem Sinne, dass wir damit unsere Haut retten für ein Leben nach dem Tod. Sondern ganz praktisch als Eintauchen in ein Leben, in dem wir „Gott mit uns“ erleben und gestalten. Und zwar nicht nur mit denen, von denen wir es erwarten – sondern oft ausgerechnet mit denen, von denen wir es nicht erwarten.
Nächstenliebe gilt nicht nur FÜR Menschen am Rand. Jesus lässt sie offensichtlich auch gerne praktizieren VON Menschen am Rand. Von denen, denen es keine/r zutraut. Von denen, bei denen niemand damit rechnet. Von denen, die es eher selber schwer haben, von anderen Nächstenliebe zu erfahren.
Die MCC Köln ist ein gutes Beispiel dafür. Alle sind sie versammelt: Pastoren, Kirchenmenschen, barmherzige Randgestalten, wirtschaftlich Gefestigte, Hilfebedürftige. Von manchen wird gemeinhin viel erwartet, von anderen zum Teil gar nichts mehr. Sie alle können in einem Moment auf sich selbst fixiert und gänzlich davon überfordert sein, aufmerksam und solidarisch gegenüber anderen zu handeln. Aber sie alle können in anderen Momenten auch die wunderbarsten Botschafter und Gestalter von Nächstenliebe sein.
Wir können das eine „anstrengende Sozialkultur“ nennen.
Wir können darin aber auch die Gegenwart Gottes entdecken und wahrnehmen.