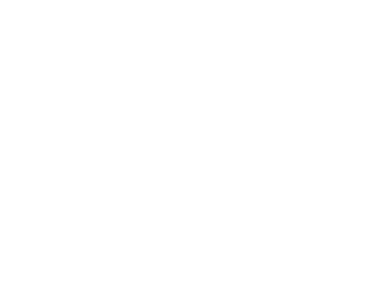Ines-Paul Baumann
4. Advent / Lk 1,5-19 / Lk 1,26-33
Ihr Lieben,
heute ist der vierte Advent. Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt bereiten wir uns auf die Geburt Jesu in einer Woche vor. – QUATSCH. Keine/r von uns bereitet sich in diesen Tagen auf die Geburt eines Kindes in einer Woche vor. Glaubt mir – als Elternteil in einer Regenbogenfamilie weiß ich mittlerweile, was Menschen tun, die sich auf die Geburt eines Kindes vorbereiten. Glühwein trinken und Festessen planen gehören nicht dazu. Wir haben einen Picknick-Korb bereitgestellt, um während der Geburt etwas Proviant zu haben. Manche der Klischees von Eltern, die sich auf eine Geburt vorbereiten, trafen auch auf uns zu. An anderen Punkten war es schwer, sich gegen das zu wehren, was von uns als werdenden Eltern erwartet wurde. „Und Sie sind sich sicher, dass Sie nicht alle Vorsorgeuntersuchungen machen wollen, um sicherzustellen, dass Sie ein gesundes Kind bekommen?“ Ja, sind wir. „Wisst ihr schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?“ NÖ. „Wie wird es denn heißen?“ Hm, keine Ahnung, mal abwarten, wer uns da geschenkt wird. „Habt ihr euch schon für einen Kindergartenplatz agemeldet?“ Äh, nee. Und wir wissen auch immer noch nicht, auf welche Schule es mal gehen wird. Wahrscheinlich haben wir während der Schwangerschaft auch nicht genug Klassik und Philosophisches Quartett gehört, um es auf seine Elite-Zukunft vorzubereiten.
Geburten in Deutschland legen fest. In wenigen Ländern Europas ist die soziale Stellung der Eltern bei der Geburt so maßgeblich für die Zukunft des Kindes. Umfeld der Eltern, Geburtsort und Geschlecht legen das Kind von Beginn an fest. Gut, dass die drei Hirten vom Feld, die Jesus in der Krippe besuchen kamen, nicht vom Statistischen Bundesamt waren. Wahrscheinlich hätten sie sich mit sorgenvollen Minen über das Kind im Stall gebeugt:
„Oh, das arme Kind. Geboren in so ärmlichen Verhältnissen. Seht euch um hier in diesem Stall. Hygienisch sehr bedenklich. Können solche Eltern ihrer Verantwortung gerecht werden? Begeben sich mitten in der Zeit der Geburt auf so eine beschwerliche Reise, tz tz. Das arme Kind. Geboren in einem Stall fernab der eigenen Heimat. Wenn es später mal einen Handyvertrag abschließen möchte oder einen Kredit aufnehmen, wird sich das aber gar nicht gut machen. Man weiß doch, wie Leute aus solchen Verhältnissen sind. Und ein Junge ist es geworden. Er wird es schwer haben. Jungs brechen doppelt so häufig die Schule ab wie Mädchen. Knapp zwei Drittel aller Privatinsolvenzen betreffen Männer (häufigste Ursche: Autofinanzierung). Der Anteil von Risikokonsumenten in Sachen Alkohol ist bei Männern fast doppelt so hoch wie bei Frauen. 84,6 % der Tatverdächtigen bei Mord sind männlich, bei Totschlag sind es sogar 87,8 %. Mehr als zwei Drittel aller Unfälle mit Verletzten werden von Männern gebaut. Da kann man sich ja vorstellen, was aus diesem Kind mal wird.“
Aber nicht nur Anhänger von Statistiken stellen Zusammenhänge von Lebensläufen und Geburts-Fakten her. Ein Hauptargument der Emanzipationsbewegungen von Schwulen, Lesben, Transgendern und Intersexuellen ist immer gewesen: „Ich habe ein Recht, so zu sein, wie ich bin, denn ich bin so geboren.“ Auch hier ist mit der Geburt etwas festgelegt, was für den Rest des Lebens maßgeblich und bestimmend ist.
Bei den Statistikern werden die meisten von uns denken: Naja, nur weil einer als Mann geboren ist, heißt das ja nicht automatisch, dass er gewalttätig wird, die Schule abbricht, Alkoholprobleme bekommt und irgendwann Privatinsolvenz anmeldet, weil er sich bei der Finanzierung seines Autos übernommen hat. Der eigene Lebenslauf ist ja zum Glück noch gestaltbar. Andererseits wissen wir, wie wichtig und prägend die eigene Herkunft ist; wie maßgeblich die eigene Entfaltung davon beeinflusst ist. Und bei dem Argument, zum Beispiel homosexuell geboren zu sein, geht es meistens darum, sich zur Wehr setzen zu müssen gegen Unterstellungen, man könne sich doch mit etwas gutem Willen auch anders verhalten.
Ob eine Sache zurecht oder zu Unrecht mit der Geburt begründet wird, hängt maßgeblich nicht von dem einzelnen Menschen ab, der da geboren wurde, sondern von dem, was andere Menschen damit auf diesen Menschen übertragen. Welche Prägungen relevant sind und einen Menschen festlegen, ist eine Frage der Gesellschaft, des Zusammenhangs, des Miteinanders. Fast immer geht es um Erwartungen, die gestellt werden. Erwartungen an Männer sind anders als an Frauen. Gebildete Eltern erwarten von ihren Kindern etwas anderes als Eltern, die selbst nie einen Schulabschluss gemacht haben. Und die Erwartungen, die wir irgendwann an uns selbst stellen, sind von alledem beeinflusst.
Auch Jesus wuchs in einer Welt voller Erwartungen auf: Erwartungen an ihn als Mann, Erwartungen an ihn als Jude, Erwartungen an ihn als Sohn eines Zimmermanns und einer Hausfrau, Erwartungen an ihn als den Jungen aus Nazareth. Die meisten dieser Erwartungen setzten Grenzen. „Was soll aus Nazareht Gutes kommen!“ (Joh 1,46). „Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen?“ (Joh 6,42) „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.“ Für den Mann Jesus galten bestimmte Regeln im Umgang mit Frauen, für den Juden Jesus galten bestimmte Regeln in Bezug auf Lebensstil und Religion.
Und was machte Jesus aus diesen Erwartungen? Jesus ging nicht den Weg, den die Menschen von ihm erwarteten, sondern den Weg, den Gott von ihm erwartete. Nicht den Weg, den die Menschen für ihn für möglich hielten, sondern den Weg, den Gott mit ihm ermöglichen würde. Nicht einen Weg, der die Erwartungen der Menschen an ihn erfüllte, sondern der die Erwartungen Gottes an ihn erfüllte – und damit die Erwartungen der Menschen oft durchbrach. Oft ließ Jesus die Menschen staunend zurück (nach Wundern, nach Heilungen, nach Beweisen seiner Vollmacht ), aber oft ließ Jesus Menschen auch enttäuscht zurück (als er eben NICHT die politische Macht an sich riss und die ganze Gesellschaft auf den Kopf stellte), oder er ließ sie empört zurück („Diese Verhalten widerspricht dem angemessenen Verhalten als Mann! Dieses Verhalten weiderspricht den religiösen Sitten!“). Jesus handelte nach den Maßstäben Gottes – auch wenn er die Maßstabe der Menschen durchaus wahrnahm. In den Begegnungen Jesu mit Menschen nahm er immer wahr, welche Vergangenheit sie hatten, in welchen Zusammenhängen und Umständen sie lebten, welche Erfahrungen sie gemacht hatten, welche Bedürfnisse sie hatten.
Jesus ging immer darauf ein, wie die Menschen lebten, was sie für Möglichkeiten hatten, mit welche Prägungen sie lebten. Aber er ließ sie nicht dabei stehen. Er legte sie damit nicht fest – weder in Bezug darauf, wie er sie in der aktuellen Begegnung sah, noch für die Zukunft, die er für sie sah. Die Vergangeheit und Prägung war wichtig, weil sie einen Menschen bis hierher gebracht hatte – aber das hieß nicht, dass das für immer so weitergehen musste. Die Jünger, die Jesus berief, waren gestandene Berufstätige Menschen. Andere, die krank waren, heilte er – nahm sie aber nicht mit. Er erwartete Unterschiedliches von Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Aber von allen erwartete er, Gott zu vertrauen, Gott anzubeten, Gott zu danken, Gott zu bitten, Gottes Handeln zu bezeugen und sich in den Dienst an Gott und an anderen Menschen zu stellen. Das war nicht „EIN Christentum für alle“ – es hieß für alle etwas anderes. Aber es hieß für alle, nicht mehr in erster Linie den Erwartungen anderer Menschen zu gehorchen, sondern sich an den Erwartungen Gottes auszurichten. Und dieser Gott erwartet etwas von den Menschen, weil Gott diese Menschen liebt. Gott WILL nicht, dass wir stehenbleiben bei dem, wie es schon immer in unserem Leben war. Gott WILL nicht, dass wir uns festlegen lassen von dem, was andere von uns erwarten. Menschen trauen uns oft zu wenig zu oder zu viel. Wir werden entweder zu wenig gefordert oder zu viel. Menschen sehen in uns oft zu wenig oder sie sehen in uns zu viel. Unser Blick auf uns selbst ist davon geprägt. In manchem sehe ich in mir zu wenig, in anderem sehe ich in mir zu viel. Die entscheidende, befreiende, klärende, öffnende Frage ist: Was sieht Gott in mir?
Manches von dem, was Gott in mir sieht, entspricht dem, was ich in mir sehe. Was andere Menschen in mir sehen. An anderen Punkten wollen andere Menschen oder ich etwas in mir sehen, was Gott gar nicht in mir sieht. Und dann gibt es die Punkte, die weder ich noch andere Menschen in mir sehen, die Gott aber schon längst sieht.
Wo ich mit Gott unterwegs bin, wird sich manches von dem, wer ich bin und wie ich lebe, bestätigen. Anderes werde ich nach und nach ablegen. Und wieder anderes wird sich nach und nach entfalten. Das, was wirklich in mir steckt, das, was Gott in mir angelegt hat, das wird zum Vorschein kommen.
Das, was in einem Menschen steckt, soll zum Vorschein kommen – nichts anderes passiert bei einer Geburt. Etwas, das in mir heranwächst, tritt ins Leben. In mir reift etwas heran, und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird es offenbar.
Als Christen und als Gemeinde ergibt sich daraus eine sehr spannende Aufgabe. Natürlich nehmen auch wir uns selbst und die Menschen um uns herum wahr mit dem, was wir mitbringen – zum Teil von Geburt an. Ob wir mehr oder weniger gebildet sind, ob wir mehr oder weniger Übung im Umgang mit gesellschaftlichen Konventionen haben, in welchem Maße unser Körper, unser Verstand oder unsere Herzlichkeit unser Leben ausmachen. Wir achten und respektieren und schätzen uns mit dem, was wir mitbringen „von Geburt an“. Aber der Clou ist, dass wir nicht bei dem stehenbleiben. Als Christen sind wir nicht nur eine Gemeinschaft von Menschen, die so oder so geboren sind und diese oder jene Vergangenheit haben – sondern wir haben auch noch diese oder jene Zukunft. Wir sehen in einander nicht nur die so-oder-so-Geborenen, sondern wir sehen uns selbst und andere auch als Menschen, in denen noch etwas steckt, was gerade erst heranwächst, was vielleicht eben noch NICHT zu sehen ist, was in uns reift, und was zum richtigen Zeitpunkt ins Leben treten wird.
Als Gemeinde sollten also wir eine Zusammenkunft von Geburtshelfern sein. Christen sind Hebammen.
Was macht Hebammen aus?
– Sie sehen etwas in einem Menschen, was anderen noch verborgen ist. (Genau das ist auch der Blick von Elisabeth, Maria und den Hirten auf Johannes und auf Jesus. Da liegen zwei kleine Bündel Kinder und sie sehen darin Berufene Gottes.)
– Hebammen glauben an diesen anderen Menschen und das, was in ihm steckt – und an seine eigene Kraft, das zum Vorschein zu bringen.Sie begleiten den Menschen in diesem Prozess. Nicht indem sie ihre eigenen Kräfte aufwenden, sondern indem sie an die Kräfte des anderen appelieren, an sein Zutrauen zu sich selber, zum richtige Tempo anstoßen (mal verlangsamend, mal beschleunigend), und indem sie das Vertrauen der anderen stärken, auf das zu hören, was sich in ihr selber abspielt.
– Sie unterstützen den anderen in Zeiten von Angst und Schmerz. Gerade an Punkten, wo es richtig wehtut, sagen sie: Weiter! Jetzt dranbleiben! Mach voran!
Sie verbinden damit kein persönliches Anliegen – es geht nur um das, was in dem anderen Menschen steckt. Was da zum Vorschein kommen soll, ist allein das, was in dem anderen Menschen herangereift ist, was in ihm steckt – was auch immer es sein mag.
– Sie können ihre Arbeit nicht machen, ohne sich auch mal die Hände schmutzig zu machen. Sie haben keine Angst vor dem, was zu unserem Leben als Menschen dazugehört – auch dann nicht, wenn es mal etwas härter zugeht oder völlig trivial. Eine Geburt ist an manchen Stellen ein ganz schön chaotischer und unsauberer Vorgang.
Als Gemeinde sind wir ein Ort, an dem Menschen das, was Gott in ihnen angelegt hat, zum Vorschein bringen. Als Christen sehen wir manchmal in anderen ein Potential, das sie selber noch gar nicht bei sich erkannt haben. Aber wir glauben an diese Menschen und an ihre Möglichkeiten. Als Gemeinde sind wir ein Zusammenhang, in dem wir im Glauben wachsen können und unsere Möglichkeiten und Energien zum Dienst aneinander freisetzen können – ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Wege, ganz unterschiedliche Ansätze. Nicht, um uns voneinander abhängig zu machen. Eine Hebamme hilft nach jeder Geburt der Mutter und dem Kind, unabhängig von ihr zu leben. Sie sollen nicht abhängig sein von ihr, sie tut nichts, was die nicht selbst tun könnten, und sie sagt ihnen nicht, wie sie ihr Leben zu leben haben.
Lasst uns auch als Gemeinde die anderen stärken im Vertrauen auf sich selbst, darauf, aus ihren eigenen Erfahrungen heraus zu leben, auf das zu hören, was in ihnen vorgeht, und dem, was da zum Vorschein kommt, etwas zuzutrauen. Genau so wenig wie bei einer Geburt geht es im Gemeindeleben nur ruhig, gelassen, klinisch sauber, korrekt und heilig-sakral zu. Manchmal ist Gemeindeleben ganz schön trivial, durcheinander, anstrengend und belastend. Aber die Hebammen wissen, warum und wofür sie es tun – sie haben den gesamten Prozess vor Augen und vor allem den Glauben an das Ergebnis: Das, was da zum Vorschein kommt, soll ins Leben treten. Als Gemeinde sind wir dafür da, dass das, was Gott in den Menschen angelegt hat, ins Leben treten kann – bei dir selbst, bei den Menschen neben dir hier in der Gemeinde, aber auch bei den Menschen, denen du in deinem Alltag begegnest. Begleite sie einfach auf dem Weg, das, was Gott in ihnen sieht, zum Vorschein zu bringen.
Nimm dir jetzt ein bisschen Zeit:
– Was sieht Gott in dir, was noch nicht zum Vorschein gekommen ist? Was die Menschen um dich herum noch nicht sehen, was du ihnen noch nicht gezeigt hast, was aber in dir steckt und was reif dafür ist, Teil deines Lebens zu sein?
– Was sieht Gott in den Menschen, mit denen du zu tun hast, was sie selbst vielleicht noch gar nicht sehen? Wie kannst du ihnen helfen, das zum Vorschein zu bringen?
– Was sieht Gott in der MCC Köln, was noch nicht zum Vorschein gekommen ist? Was für ein Potential hat Gott in dieser Gemeinde angelegt, was noch entdeckt und verwirklicht werden sollte? Was ist deine Rolle dabei?
(Danke für Anregungen an William M. Easum und Thomas G. Bandy für die „Midwife Metaphor“ in „Growing Spiritual Redwoods“)